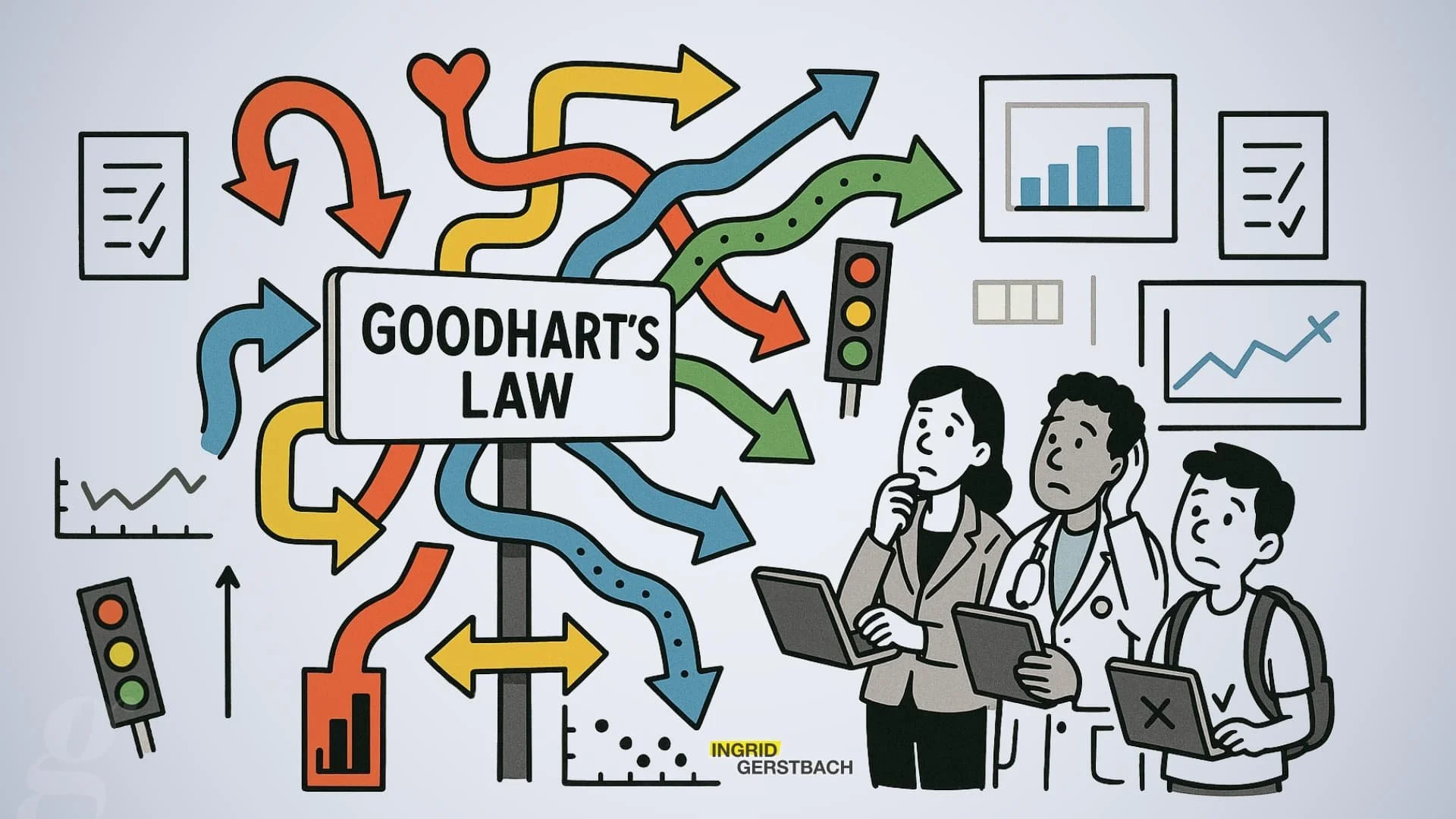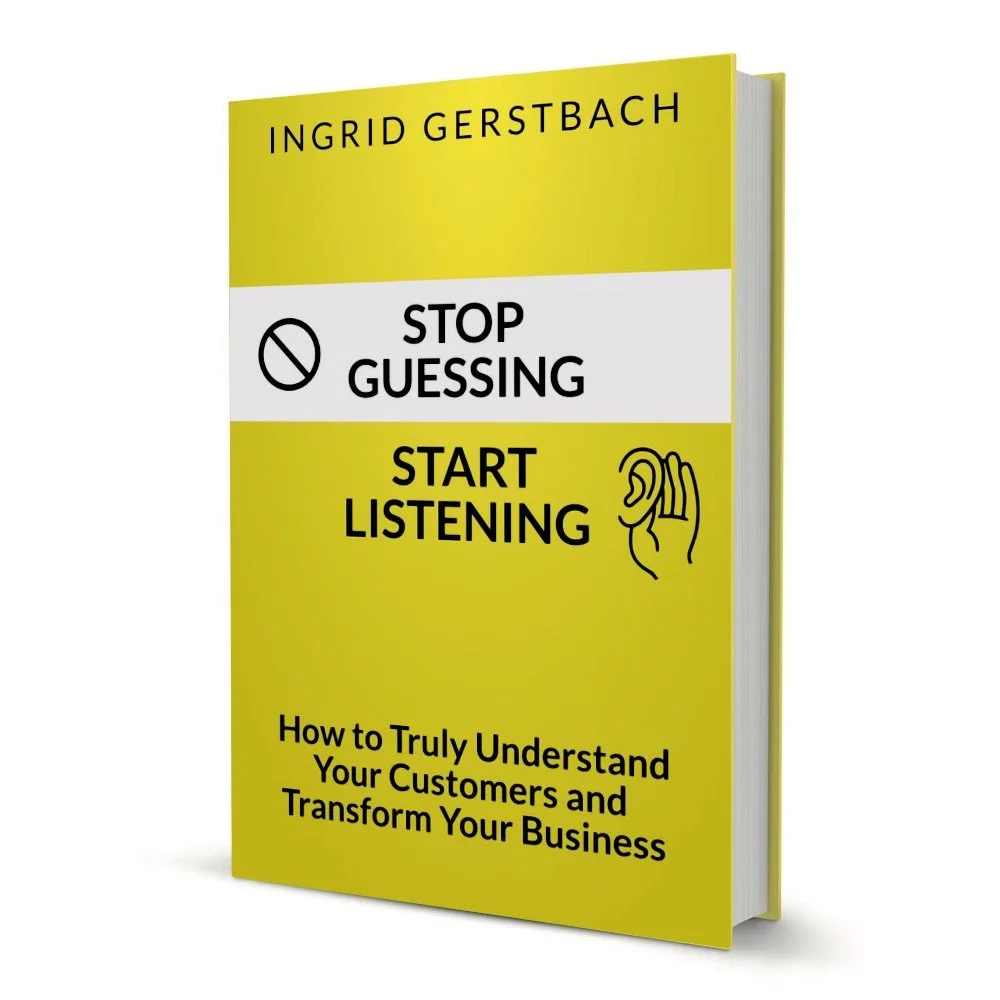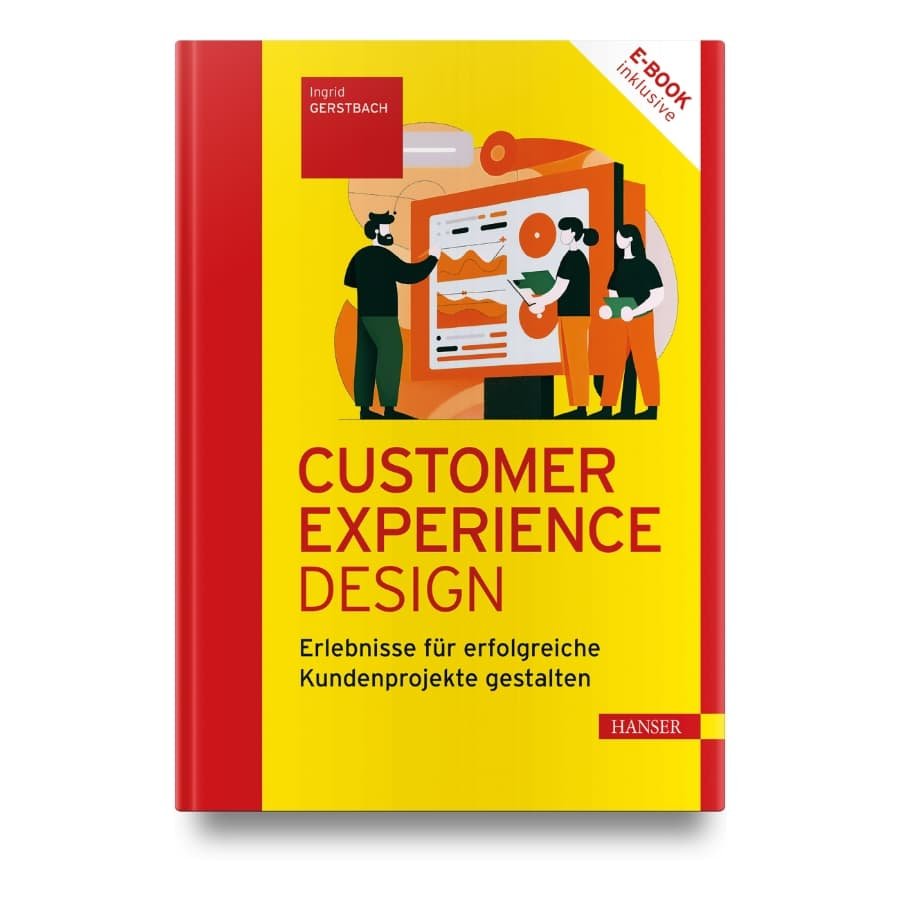Es war ein Dienstagmorgen, als mir ein Freund, der als Lehrer arbeitet, seine Frustration mitteilte. „Weißt du“, sagte er, während er seinen Kaffee umrührte, „ich verbringe mehr Zeit damit, Testergebnisse zu dokumentieren, als tatsächlich zu unterrichten“. Seine Schule hatte ein neues Bewertungssystem eingeführt, das die Leistung der Lehrer anhand der Testergebnisse ihrer Schüler maß. Das Ergebnis? Lehrer konzentrierten sich obsessiv darauf, ihre Schüler auf Tests vorzubereiten, anstatt kritisches Denken zu fördern oder Kreativität zu entwickeln.
Mein Freund war unwissentlich Opfer eines der tückischsten Gesetze der Sozialwissenschaften geworden: Goodhart’s Law.
Charles Goodhart, ein britischer Ökonom, formulierte 1975 eine scheinbar einfache Beobachtung: „Wenn eine Kennzahl zu einem Ziel wird, hört sie auf, eine gute Kennzahl zu sein“. Auf den ersten Blick mag das abstrakt klingen, aber die Auswirkungen durchdringen jeden Aspekt unseres Lebens.
Denken Sie an die sozialen Medien. Ursprünglich sollten Likes und Shares die Qualität von Inhalten messen. Doch sobald Menschen begannen, diese Metriken als Ziele zu betrachten, veränderte sich alles. Plötzlich optimierten Content-Ersteller nicht mehr für Wahrheit oder Tiefe, sondern für mehr Likes. Das Ergebnis? Eine Flut von Clickbait, polarisierenden Inhalten und oberflächlichen Diskussionen.
Die Ironie ist perfekt: Die Messung, die uns helfen sollte, Qualität zu erkennen, zerstörte genau diese Qualität.
Goodhart's Law funktioniert durch einen psychologischen Mechanismus, den Verhaltensforscher „Zielersetzung“ nennen. Wenn Menschen wissen, dass sie anhand bestimmter Kennzahlen beurteilt werden, richten sie ihr Verhalten natürlich darauf aus, diese Kennzahlen zu optimieren – oft auf Kosten des ursprünglichen Ziels.
Nehmen wir das Gesundheitswesen. Krankenhäuser, die anhand ihrer Sterblichkeitsrate bewertet werden, könnten versucht sein, schwerkranke Patienten abzulehnen, um ihre Statistiken zu verbessern. Ärzte, die nach der Anzahl der Patientenkontakte bezahlt werden, könnten unnötige Termine ansetzen. Die Messung der Effizienz untergräbt die Fürsorge.
In der Wirtschaft sehen wir dasselbe Muster. Rufen Sie sich die Finanzkrise von 2008 in Erinnerung: Banken wurden dafür belohnt, möglichst viele Kredite zu vergeben, ohne dass die Qualität dieser Kredite angemessen berücksichtigt wurde. Die Kennzahl – Kreditvolumen – wurde zum Ziel, und die ursprüngliche Absicht – verantwortliche Kreditvergabe – ging verloren.
Warum verfallen wir immer wieder in diese Falle? Die Antwort liegt in unserem tiefen Bedürfnis nach Kontrolle und Gewissheit. Zahlen versprechen Objektivität in einer subjektiven Welt. Sie bieten scheinbare Klarheit in komplexen Situationen.
Außerdem sind Kennzahlen verführerisch einfach. Es ist schwer zu definieren, was „gute Erziehung“ oder „Patientenzufriedenheit“ bedeutet, aber es ist einfach, Testergebnisse oder Behandlungszeiten zu messen. Wir wählen das Messbare über das Bedeutsame. Der französische Philosoph Henri Bergson warnte bereits vor dieser Tendenz: Wir neigen dazu, die lebendige Wirklichkeit in statische Kategorien zu pressen, wodurch wir das Wesentliche verlieren.
Diese Vorliebe für Quantifizierung ist nicht grundsätzlich schlecht. Daten können mächtige Werkzeuge sein, um Fortschritte zu verfolgen und Verbesserungen zu identifizieren. Das Problem entsteht, wenn wir die Landkarte mit dem Gebiet verwechseln – wenn wir glauben, dass unsere Messungen die Realität vollständig erfassen, anstatt nur einen Ausschnitt davon zu zeigen.
Wie können wir also der Goodhartschen Falle entkommen? Die Lösung ist nicht, auf Messungen zu verzichten, sondern weiser mit ihnen umzugehen.
Erstens müssen wir akzeptieren, dass die wichtigsten Dinge oft am schwierigsten zu messen sind. Vertrauen, Kreativität, Weisheit, Mitgefühl – diese Qualitäten entziehen sich einfachen Metriken, sind aber entscheidend für ein erfülltes Leben und eine funktionierende Gesellschaft. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hätte gesagt: Das, was uns am tiefsten bewegt, geschieht jenseits der Messbarkeit – in der Innerlichkeit des Einzelnen.
Zweitens sollten wir mehrere Kennzahlen verwenden, anstatt uns auf eine einzige zu verlassen. Wenn Lehrer nur anhand der Testergebnisse beurteilt werden, werden sie für Tests unterrichten. Wenn sie zusätzlich anhand der Kreativität ihrer Schüler, ihrer sozialen Entwicklung und ihrer Liebe zum Lernen bewertet werden, entsteht ein vollständigeres Bild.
Drittens müssen wir regelmäßig unsere Kennzahlen überprüfen und anpassen. Wenn eine Messung beginnt, das Verhalten zu verzerren, ist es Zeit, sie zu ändern oder zu ergänzen.
Vielleicht ist die wichtigste Lektion von Goodhart’s Law diese: Die besten Dinge im Leben – Liebe, Freundschaft, Sinn, Schönheit – lassen sich nicht quantifizieren. Und das ist auch gut so. Wenn wir versuchen, alles zu messen, riskieren wir, das zu verlieren, was wirklich zählt.
Mein Freund, der Lehrer, hat übrigens eine Lösung gefunden. Er dokumentiert pflichtbewusst seine Testergebnisse, aber er lässt sie nicht sein Unterrichten bestimmen. Er erinnert sich jeden Tag daran, warum er Lehrer wurde: um junge Menschen zu inspirieren, zu fordern und zu unterstützen. Keine Kennzahl kann das erfassen, aber seine Schüler spüren den Unterschied.
In einer Welt, die von Daten besessen ist, ist das vielleicht die radikalste Haltung von allen: zu erkennen, dass nicht alles, was zählt, gezählt werden kann – und dass nicht alles, was gezählt werden kann, zählt.
Die Weisheit liegt nicht darin, Messungen zu verteufeln, sondern darin, sie als das zu sehen, was sie sind: unvollkommene Werkzeuge in den Händen unvollkommener Menschen. Wenn wir das verstehen, können wir sie nutzen, ohne von ihnen beherrscht zu werden.
Das ist eine Lektion, die sich nicht quantifizieren lässt. Und vielleicht ist genau das ihre Stärke.
—
Apropos: Goodhart’s Law finden Sie neben weiteren Denkfallen in meinem Buch „Die 7 Ausreden der Unternehmen”.