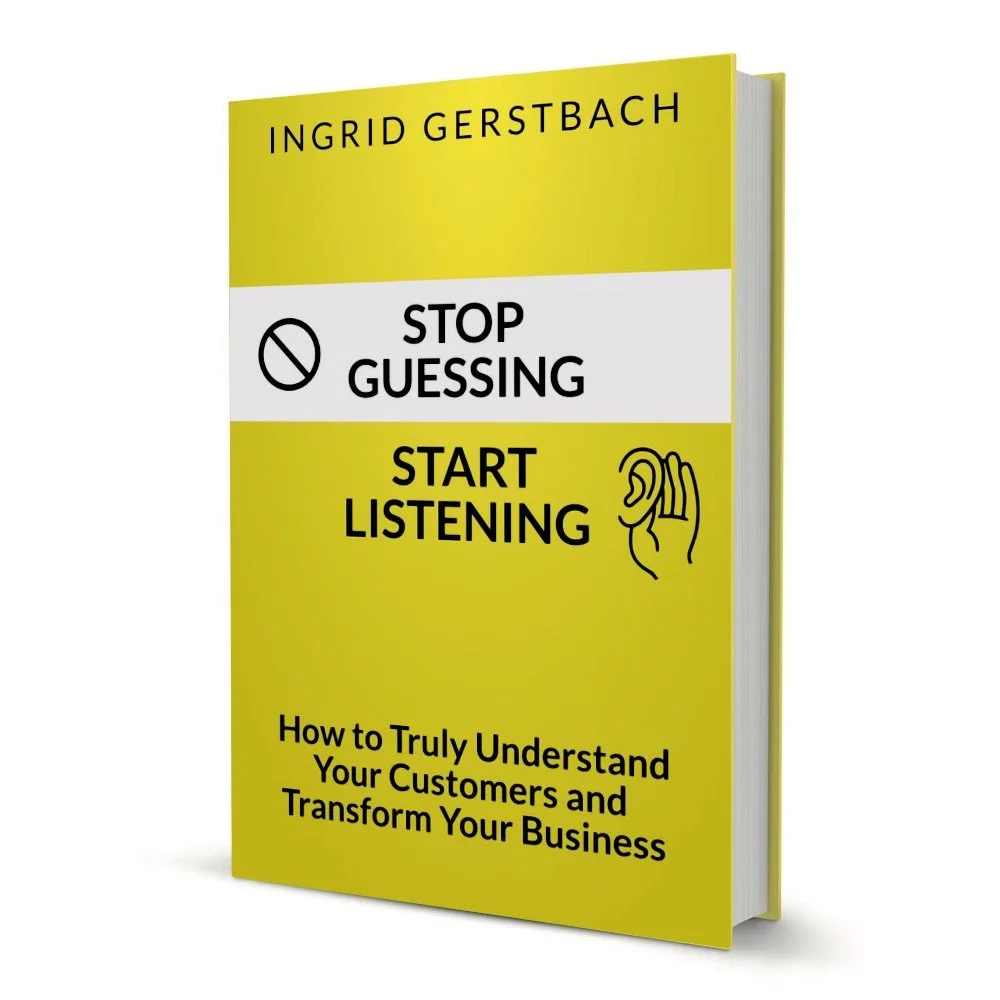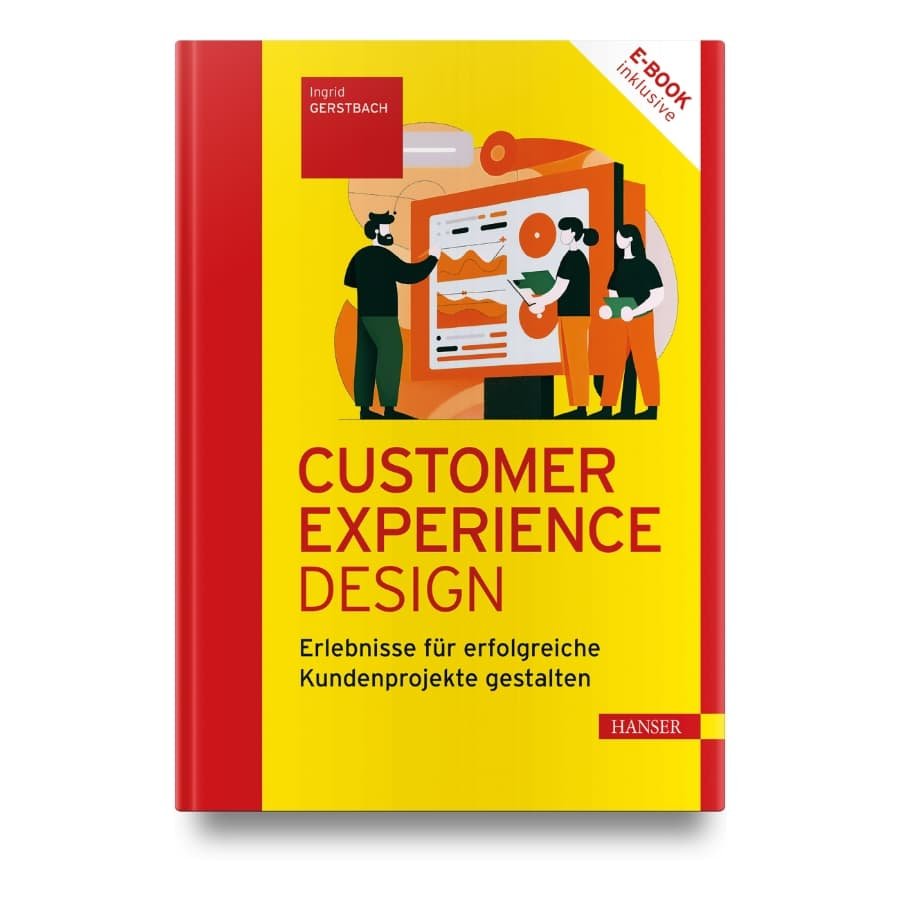Als mein Mann und ich vor einigen Jahren in unser Haus zogen, beschlossen wir, ein Bücherregal selbst zu basteln. Nach drei Stunden, fünf falschen Versuchen und einem kleinen Ehestreit stand es endlich – nicht perfekt, aber unser Werk. Als ein Freund später anbot, uns dieses selbstgebaute Regal zu einem großzügigen Preis abzukaufen, lehnten wir ohne zu zögern ab. Das selbstgebaute Regal hatte für uns einen unschätzbaren Wert erlangt.
Diese scheinbar irrationale Entscheidung ist ein Beispiel für den „IKEA-Effekt“ – ein Phänomen, das Sozialpsychologen bereits vielfach untersucht haben. Ihre Erkenntnis: Wir bewerten Dinge, an deren Erschaffung wir beteiligt waren, systematisch höher als ihren objektiven Wert. Und dieses Prinzip prägt nicht nur unsere Einrichtungsentscheidungen, sondern auch, wie wir Ideen entwickeln, bewerten und – oft zu unserem Nachteil – an ihnen festhalten.
Dafür gibt es tatsächlich einen guten evolutionären Grund. Unsere Vorfahren, die sich intensiv um ihre Schöpfungen kümmerten – ihre Werkzeuge, ihre Unterkünfte, ihre Gemeinschaften – pflegten und verbesserten sie eher. Der Jäger, der seinen handgefertigten Speer schätzte, hielt ihn scharf; die Sammlerin, die ihren Korb liebte, reparierte ihn, wenn er ausfranste. Diese emotionale Investition in unsere Arbeit half unserer Spezies zu überleben.
Aber was uns in der Savanne gut diente, kann uns im Unternehmen (und auch Zuhause) sabotieren. Wenn wir unsere Zeit, Energie und Identität in eine Idee stecken, können wir sie buchstäblich nicht mehr klar sehen. Sie hört auf, nur eine Idee zu sein, und wird Teil dessen, wer wir sind.
Ich habe beobachtet, wie sich das in Organisationen auf drei vorhersagbare Weisen abspielt.
Erstens gibt es das, was Forscher das „Not-Invented-Here”-Syndrom nennen – die reflexartige Ablehnung externer Ideen nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie fremd sind. Ich saß einmal in einem Meeting, in dem Führungskräfte zwei Stunden damit verbrachten zu erklären, warum sie eine Durchbruchstechnologie selbst hätten entwickeln können, anstatt zu diskutieren, wie sie sie tatsächlich nutzen könnten.
Zweitens überbewerten wir unsere bestehenden Lösungen einfach, weil sie unsere sind. Es ist wie das alte Küchengerät, das man nie benutzt, aber nicht wegwerfen kann, weil man sich daran erinnert, wie aufgeregt man war, als man es gekauft hat. Organisationen klammern sich an veraltete Prozesse und ineffiziente Systeme, weil sie vergangene Investitionen repräsentieren – was Ökonomen „versunkene Kosten” nennen.
Drittens, und am gefährlichsten, nehmen wir Kritik an unseren Ideen als persönliche Angriffe wahr. Ich habe brillante, rationale Menschen gesehen, die defensiv und emotional wurden, wenn jemand vorschlug, ihre Arbeit zu modifizieren. Ihre berufliche Identität ist so sehr mit ihren Schöpfungen verwoben, dass eine Änderung der Arbeit sich anfühlt, als würde man sie selbst verändern.
Aber hier wird es interessant: Der IKEA-Effekt ist nicht nur ein lästiger Denkfehler. Er ist auch der Grund, warum wir überhaupt etwas zu Ende bringen. Die gleiche irrationale Liebe zu unseren Ideen, die uns manchmal in die Irre führt, ist auch das, was uns durch schwierige Zeiten trägt. Sie sorgt dafür, dass wir nicht beim ersten Rückschlag aufgeben, sondern weitermachen, wenn andere längst das Handtuch geworfen hätten.
Der Schlüssel liegt darin zu lernen, diese Kraft zu nutzen, anstatt von ihr kontrolliert zu werden. Denken Sie daran wie an Feuer: gefährlich, wenn es sich unkontrolliert ausbreitet, aber essentiell, wenn es richtig eingedämmt wird.
Die gute Nachricht ist, dass Bewusstsein schon die halbe Miete ist. Hier sind drei Strategien, die ich hilfreich finde:
Praktizieren Sie bewusstes Innehalten: Bevor Sie eine wichtige Entscheidung treffen, fragen Sie sich: „Überbewerte ich das, weil ich dabei geholfen habe, es zu erschaffen?” Diese eine Frage kann durch Schichten der Selbsttäuschung schneiden. Ich kenne einen CEO, der von seinem Team jetzt verlangt, diese Frage schriftlich zu beantworten, bevor jede wichtige strategische Entscheidung getroffen wird.
Suchen Sie nach widersprechenden Beweisen: Unser Gehirn ist darauf gepolt, Informationen zu bemerken, die bestätigen, was wir bereits glauben. Bekämpfen Sie das, indem Sie aktiv nach Gründen suchen, warum Ihre bevorzugte Option falsch sein könnte. Machen Sie es zur Regel: Schreiben Sie für jede wichtige Entscheidung mindestens drei Argumente gegen Ihre Position auf.
Nutzen Sie den Freundestest: Stellen Sie sich vor, ein enger Freund käme mit genau Ihrer Situation zu Ihnen. Was würden Sie ihm sagen? Dieser einfache mentale Trick schafft emotionale Distanz und hilft Ihnen, klarer zu sehen. Wir sind fast immer besser darin, Ratschläge zu geben als sie anzunehmen.
Die erfolgreichsten Innovatoren, die ich kenne, haben ein Paradox gemeistert: Sie sind zutiefst leidenschaftlich bei ihrer Arbeit und bleiben gleichzeitig ungebunden an jede bestimmte Version davon. Sie lieben ihre Ideen genug, um sie zu nähren, aber nicht so sehr, dass sie sie nicht ändern könnten.
Das erinnert mich an eine Weisheit aus der buddhistischen Tradition: Die Kunst liegt darin, sich um etwas zu kümmern, ohne es kontrollieren zu wollen. Dasselbe Prinzip gilt für unsere Ideen. Wir müssen uns tiefgreifend um sie kümmern, während wir akzeptieren, dass sie vielleicht in Weisen wachsen müssen, die wir uns nie vorgestellt haben.
Ihr nächster Durchbruch könnte erfordern, etwas aufzugeben, woran Sie monatelang oder jahrelang gearbeitet haben. Die Frage ist nicht, ob Sie es sich leisten können loszulassen – sondern ob Sie es sich leisten können, es nicht zu tun. Denn manchmal ist das Mutigste, was Sie tun können, zuzugeben, dass Ihre schöne, handgebaute, emotional kostbare Idee nicht mehr zu Ihnen passt.
Genau wie wir irgendwann aus unserem ersten IKEA-Regal herauswachsen und es gegen etwas Solideres eintauschen, müssen wir manchmal auch unsere liebgewonnenen Ideen durch bessere ersetzen. Die Kunst liegt darin, dankbar für das zu sein, was uns bis hierher gebracht hat, während wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen.
—
Apropos: Den IKEA-Effekt finden Sie neben weiteren Denkfallen in meinem Buch „Die 7 Ausreden der Unternehmen”.