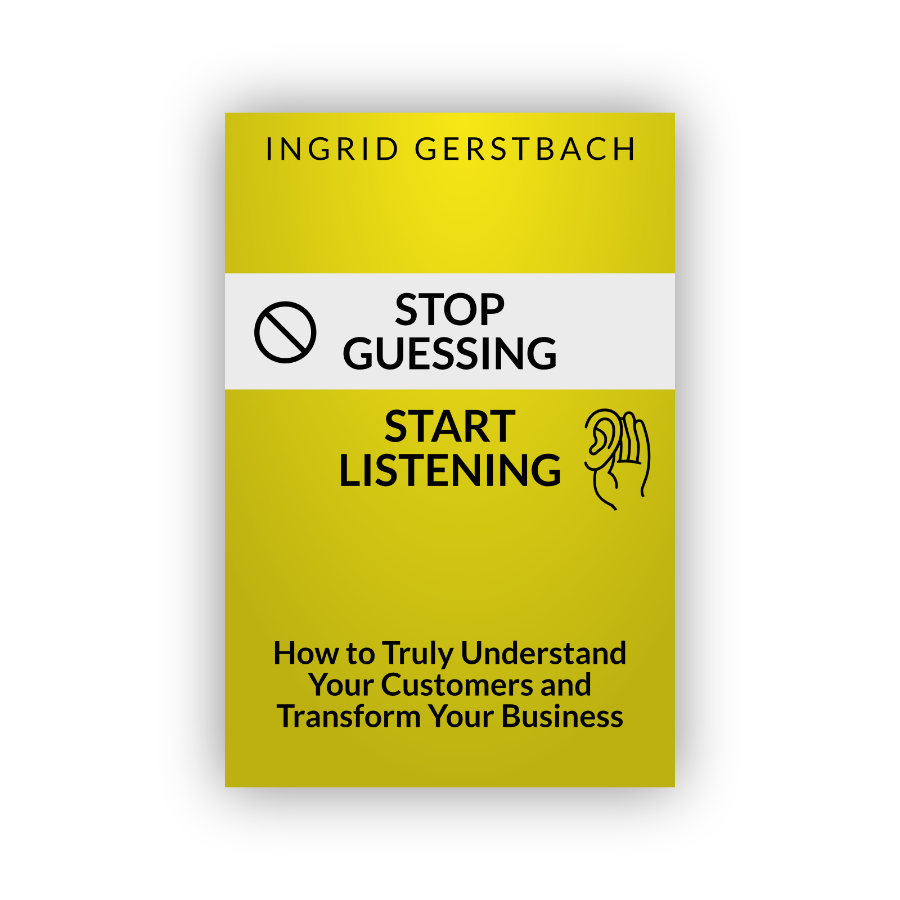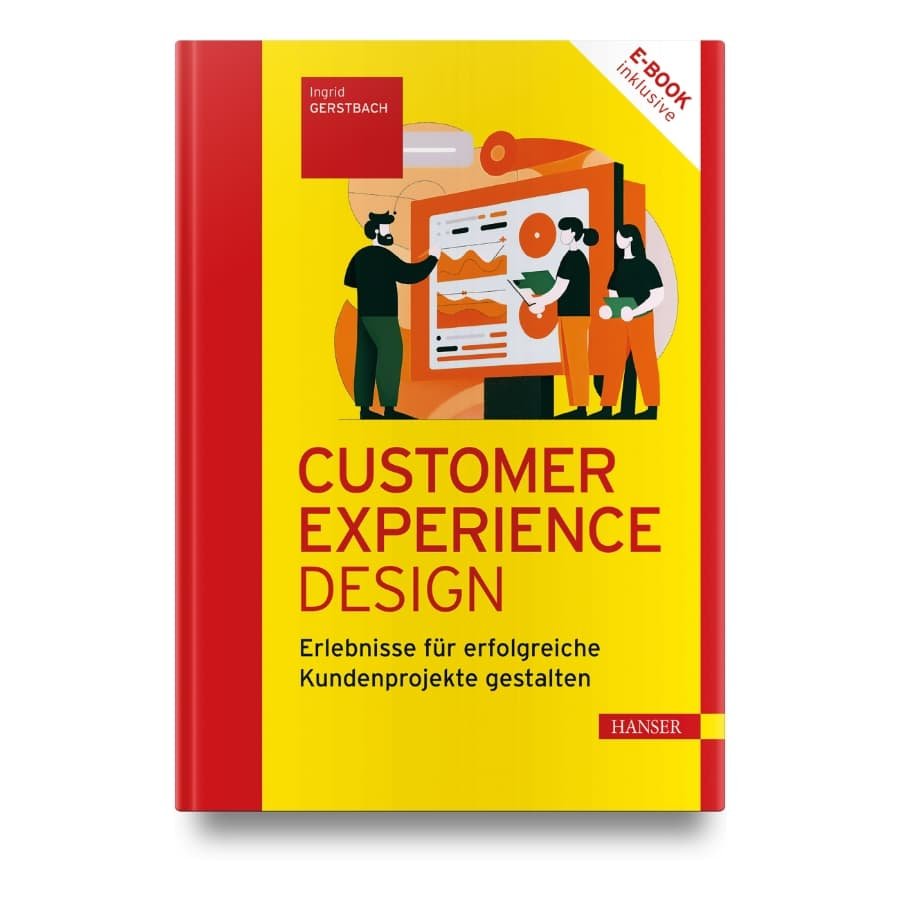Letzte Woche ertappte ich mich dabei, wie ich mein Büro aufräumte – und zwar nicht, weil es nötig gewesen wäre, sondern weil ich vor einer wichtigen Deadline stand. Während ich Bücher alphabetisch sortierte und Kabel ordnete, wusste ein Teil von mir genau, was ich tat: Ich schuf mir eine Ausrede. Falls der Artikel nicht gut werden würde, könnte ich sagen: „Nun ja, ich war ja auch völlig abgelenkt von diesem Chaos hier…“.
Es ist ein Ritual, das ich aus meiner Jugend kenne, als ich vor Prüfungen plötzlich das dringende Bedürfnis verspürte, mein Zimmer aufzuräumen. Damals dachte ich, es wäre simple Prokrastination – die alltägliche Schwäche, unangenehme Aufgaben aufzuschieben. Heute weiß ich, dass es etwas viel Gefährlicheres und Raffiniertes war. Denn ich wollte die Prüfung nicht vermeiden – ich wollte sie schreiben. Aber ich wollte auch eine Erklärung parat haben, falls sie nicht gut lief. Es war der unbewusste Versuch, mich vor der schmerzhaften Wahrheit zu schützen, dass mein Bestes vielleicht nicht gut genug sein könnte.
Dieses Verhalten hat einen Namen: Self-Handicapping. Wir bauen uns bewusst Hürden, nicht obwohl wir Erfolg wollen, sondern gerade weil wir ihn so sehr wollen. Es ist die perverse Logik einer Kultur, die uns beigebracht hat, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir außergewöhnlich sind – und gleichzeitig, dass Versagen eine existenzielle Bedrohung darstellt.
Ich denke oft daran, dass Self-Handicapping möglicherweise die natürliche Antwort auf eine unnatürliche Frage ist: „Wer bin ich, wenn ich nicht erfolgreich bin?“ In früheren Jahrhunderten war die Identität der Menschen durch Familie, Gemeinschaft, religiöse Zugehörigkeit definiert. Heute sollen wir uns selbst durch unsere Leistungen erschaffen – eine unmögliche Aufgabe,die zu chronischer Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit führt
In einer wegweisenden Studie von Berglas und Jones aus dem Jahr 1978 erhielten Studierende vor einem erfolgreichen Test die Wahl zwischen zwei Medikamenten – eines würde angeblich ihre Leistung verbessern, das andere verschlechtern. Erschreckend viele männliche Teilnehmer wählten bewusst das leistungshemmende Mittel. Sie zogen es vor, mit einer Ausrede zu scheitern, als ohne Ausrede zu versagen. Aber was diese Studie wirklich enthüllt, ist nicht nur ein psychologisches Phänomen – es ist ein Spiegel unserer kollektiven Angst vor der eigenen Endlichkeit.
Denn das ist es, was wir wirklich fürchten, wenn wir uns selbst sabotieren, ist nicht das Scheitern an sich, sondern die Erkenntnis, dass unsere Fähigkeiten Grenzen haben. In einer Kultur, die uns verspricht, wir könnten alles werden, wenn wir nur hart genug arbeiten, ist die Entdeckung unserer Begrenztheit nicht nur eine Enttäuschung – sie erschüttert unser ganzes Selbstverständnis.
Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem lieben Nachbarn, lange bevor ich diese psychologischen Mechanismen verstand. Er war ein sehr einfacher Mann, der nie eine Universität besucht hatte, aber eine tiefe Weisheit über das Leben besaß. „Der größte Mut ist nicht der, mit dem du Berge versetzt. Es ist der Mut, dich selbst kennenzulernen – auch wenn dir nicht gefällt, was du findest. Denn erst dann kannst du in Frieden mit dir selbst leben.“ Damals verstand ich nicht, was er meinte. Heute erkenne ich darin eine alternative Vision des menschlichen Werts – eine, die nicht auf Leistung, sondern auf Selbstakzeptanz beruht.
Self-Handicapping ist, so glaube ich, letztendlich ein verzweifelter Versuch, das Unmögliche zu schaffen: ein Leben ohne Begrenzungen. Es ist der moderne Mythos des Ikarus, nur dass wir uns diesmal selbst die Flügel brechen, bevor wir zu hoch fliegen können. Wir leben in einer Zeit, in der Mittelmäßigkeit als Sünde gilt und Scheitern als persönliches Versagen interpretiert wird. Ist es da verwunderlich, dass unsere talentiertesten Menschen – diejenigen, die am meisten zu verlieren haben – sich selbst sabotieren?
Aber vielleicht liegt in diesem Verhalten auch eine unbewusste Weisheit. Vielleicht spüren die Menschen intuitiv, dass ein Leben, das nur aus der Jagd nach Erfolg besteht, ein verarmtes Leben ist. Vielleicht ist Self-Handicapping eine unbewusste Rebellion gegen eine Kultur, die uns auf unsere Produktivität reduziert.
Die tragische Ironie ist, dass diese Form der Rebellion uns nicht befreit, sondern noch tiefer in die Falle führt. Denn indem wir uns selbst sabotieren, bestätigen wir genau die Logik, der wir zu entkommen versuchen: dass unser Wert von unseren Leistungen abhängt. Wir werden zu Gefangenen eines Systems, das wir gleichzeitig ablehnen und perpetuieren.
Wie können wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen? Der erste Schritt ist paradoxerweise nicht ein besseres Leistungsmanagement, sondern eine fundamentale Neubewertung der Frage nach dem menschlichen Wert. Wir müssen lernen, zwischen dem zu unterscheiden, was wir tun, und dem, wer wir sind. Das ist keine oberflächliche Unterscheidung – es ist eine spirituelle Praxis.
Ich habe gelernt, vor wichtigen Projekten ein kleines Ritual durchzuführen. Ich frage mich nicht nur: „Baue ich mir gerade Ausreden?“ Sondern auch: „Wer wäre ich, wenn dieses Projekt nicht existieren würde? Was an mir ist unabhängig von diesem Erfolg oder Misserfolg wertvoll?“ Diese Fragen helfen mir zu erkennen, dass mein Kern – das, was mich als Menschen ausmacht – nicht auf dem Spiel steht.
Zweitens müssen wir lernen, Scheitern nicht als Endpunkt, sondern als Information zu betrachten. Scheitern zeigt uns unsere Grenzen – und das ist keine Tragödie, sondern ein Geschenk. Denn nur wer seine Grenzen kennt, kann authentisch leben. Die Alternative ist ein Leben in ständiger Angst vor der Entdeckung dessen, wer man wirklich ist.
Drittens braucht es eine Art „mutiger Demut“ – den Mut, sich vollständig zu zeigen, gekoppelt mit der Demut, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Das bedeutet, sich bewusst in Situationen zu begeben, in denen man scheitern kann, aber dieses mögliche Scheitern nicht als existenzielle Bedrohung zu betrachten, sondern als Teil des menschlichen Daseins.
Wir haben eine Generation herangezogen, die glaubt, sie müsse perfekt sein, um geliebt zu werden. Self-Handicapping ist vielleicht der verzweifelte Versuch, diese unmögliche Gleichung zu lösen. Aber die wahre Lösung liegt nicht darin, die Leistung zu optimieren – sie liegt darin, die Gleichung selbst in Frage zu stellen.
Am Ende geht es bei Self-Handicapping nicht um Leistungspsychologie. Es geht um die tiefste aller menschlichen Fragen: Können wir uns selbst lieben, auch wenn wir nicht außergewöhnlich sind? Können wir ein erfülltes Leben führen, ohne das Versprechen grenzenloser Selbstverwirklichung? Können wir Frieden mit unserer eigenen Endlichkeit schließen?
Diese Fragen haben keine einfachen Antworten. Aber sie zu stellen ist bereits der erste Schritt heraus aus der Falle des Self-Handicapping – und hinein in ein Leben, das nicht von der Angst vor dem eigenen Ungenügen bestimmt wird, sondern von der Akzeptanz dessen, wer wir wirklich sind.