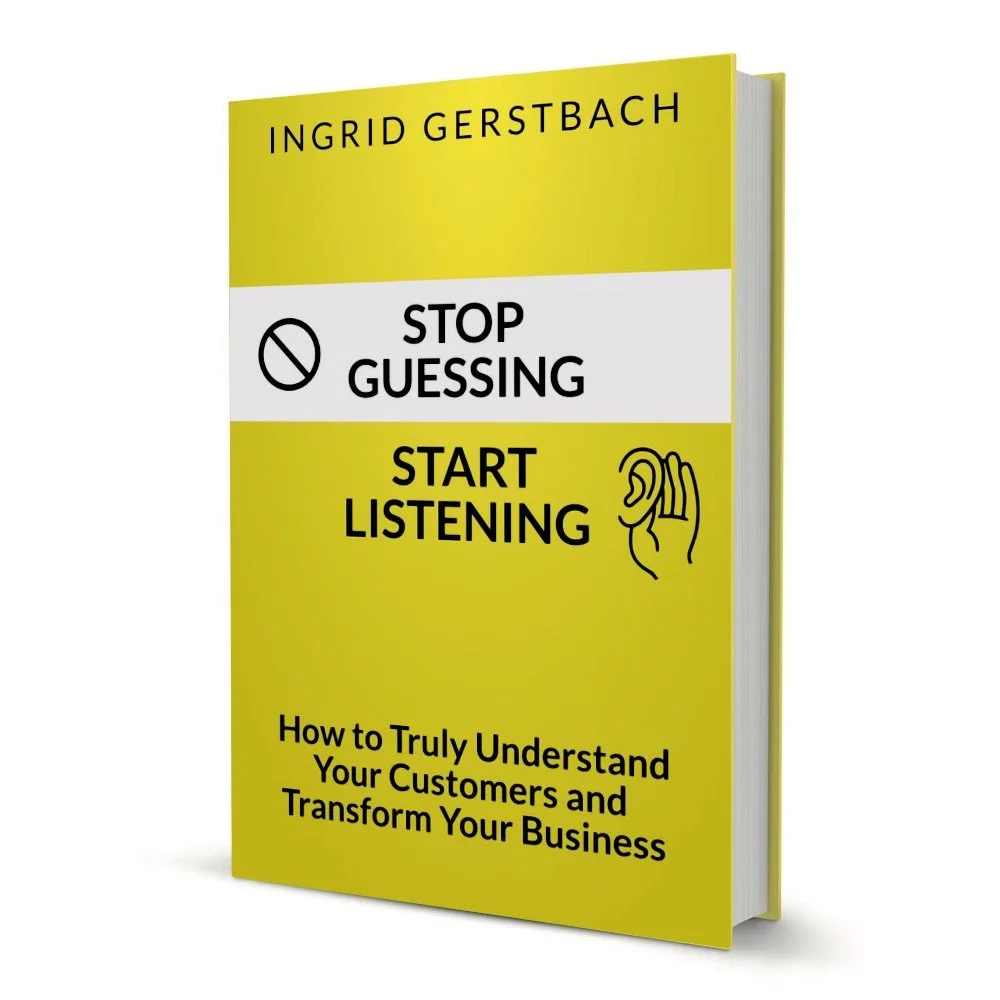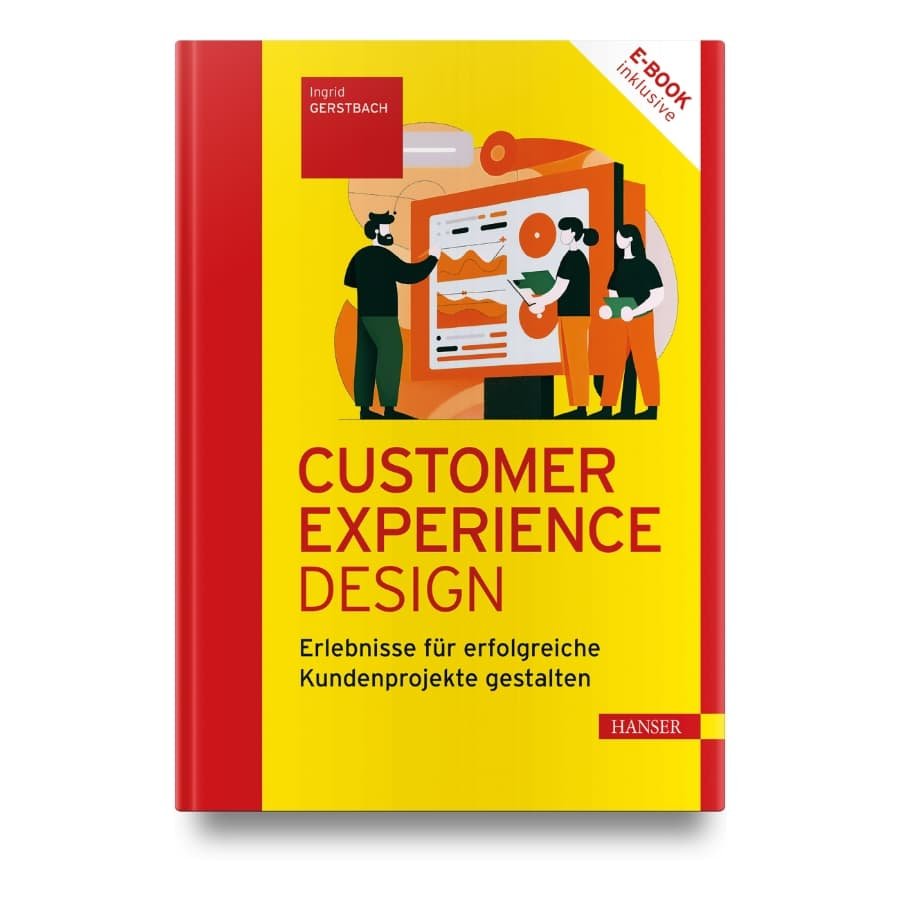Vor einigen Jahren führte eine Lehrerin in einer amerikanischen Grundschule ein Experiment durch, das heute als bahnbrechend gilt. Ihr wurde gesagt, dass einige ihrer Schüler laut einem Test über außergewöhnliches intellektuelles Potenzial verfügten. Unbewusst behandelte sie diese Kinder anders: Sie gab ihnen mehr Zeit für Antworten, forderte sie stärker heraus und zeigte mehr Geduld bei Fehlern. Am Ende des Jahres hatten genau diese Schüler deutlich bessere Leistungen erbracht – unabhängig davon, ob sie tatsächlich begabter waren oder nicht. Die Wahrheit: Der Test war erfunden, die Schüler zufällig ausgewählt. Was ihre Leistung steigerte, waren allein die Erwartungen der Lehrerin.
Dieses Phänomen ist als Pygmalion-Effekt bekannt: Hohe Erwartungen führen zu besseren Leistungen. Der Name geht auf die griechische Mythologie zurück – der Bildhauer Pygmalion erschuf eine Statue, die so perfekt war, dass er sich in sie verliebte. Durch seine unerschütterliche Überzeugung erwachte sie schließlich zum Leben. Das Gegenteil – niedrige Erwartungen, die zu schlechteren Leistungen führen – nennt man Golem-Effekt, benannt nach der jüdischen Legende vom Golem, einer Kreatur aus Lehm, die durch die Erwartungen ihres Schöpfers entweder zum Beschützer oder zur Bedrohung werden konnte. Beide Effekte spielen nicht nur in Schulen oder Unternehmen eine Rolle, sondern überall dort, wo Menschen durch die Erwartungen anderer beeinflusst werden: im Freundeskreis, in Familien oder im beruflichen Kontext.
Studien zeigen, dass Führungskräfte und Kollegen oft unbewusst Signale senden, die beeinflussen, wie wir wahrgenommen und behandelt werden. Wer als talentiert gilt, bekommt häufiger Chancen, erhält mehr konstruktives Feedback und wird stärker gefördert. Wer als durchschnittlich oder gar „problematisch” eingestuft wird, wird oft übersehen, bekommt weniger spannende Aufgaben und bleibt unter seinen Möglichkeiten – ein Teufelskreis, der Selbstzweifel nährt.
In einem Callcenter-Experiment wurde eine Gruppe von Mitarbeitenden zufällig als „vielversprechend“ eingestuft. Ihre Vorgesetzten wussten nichts von der Willkür dieser Auswahl – sie verhielten sich den angeblichen High Performern aber automatisch unterstützender, gaben ihnen mehr Verantwortung und hörten ihnen aufmerksamer zu. Das Ergebnis? Diese Mitarbeiter waren tatsächlich produktiver als ihre Kollegen, die nicht als „vielversprechend“ markiert wurden. Der einzige Unterschied war die Erwartungshaltung.
Die gute Nachricht: Sie können diesen Effekt für sich selbst nutzen. Es geht nicht nur darum, welche Erwartungen andere an Sie haben, sondern auch darum, wie Sie sich selbst sehen und verhalten.
Glauben Sie an sich selbst – wirklich. Selbstvertrauen ist mehr als nur eine innere Haltung – es zeigt sich in Ihrer Körpersprache, Ihrer Stimme und den Entscheidungen, die Sie treffen. Wenn Sie sich selbst als kompetent wahrnehmen, senden Sie unbewusst Signale aus, die andere wahrnehmen und spiegeln. Fragen Sie sich: Wie würde jemand auftreten, der meine Ziele bereits erreicht hat? Übernehmen Sie diese Haltung bewusst in Ihren Alltag.
Fordern Sie Chancen ein – und zeigen Sie, dass Sie sie verdient haben. Oft warten Menschen darauf, entdeckt zu werden. Doch wer sichtbar wird, erhöht seine Chancen auf Förderung erheblich. Melden Sie sich freiwillig für neue Aufgaben, bringen Sie eigene Ideen ein und zeigen Sie Initiative. Wenn Sie Verantwortung übernehmen, verändert sich die Wahrnehmung anderer: Plötzlich gelten Sie als eine Person, der man mehr zutraut – und genau das kann neue Chancen eröffnen.
Hinterfragen Sie negative Erwartungen – auch Ihre eigenen. Wenn Sie spüren, dass Ihnen wenig zugetraut wird, reflektieren Sie: Ist das eine objektive Einschätzung oder eine unbewusste Voreingenommenheit? Vielleicht sind es alte Muster oder eine Rolle, in der man Sie sieht, aus der Sie längst herausgewachsen sind. Falls Sie sich selbst in eine Schublade stecken („Ich bin eben nicht so kreativ“ oder „Ich bin kein Führungstyp“), hinterfragen Sie auch diese Überzeugungen. Oft stehen wir uns selbst mehr im Weg als andere es tun.
Wir alle sind von Erwartungen umgeben, die unsere Leistung beeinflussen. Doch anstatt nur darauf zu reagieren, haben wir die Möglichkeit, unsere eigene Realität aktiv mitzugestalten. Erwartungen – ob von außen oder von uns selbst – sind kein statisches Urteil, sondern ein beweglicher Rahmen, den wir erweitern oder verschieben können. Wer beginnt, sich selbst als fähig und entwicklungsfähig zu sehen, setzt eine Dynamik in Gang: Andere nehmen diese Haltung wahr, sie formen ihr Verhalten entsprechend – und plötzlich eröffnen sich neue Chancen.
Doch hier liegt auch eine Verantwortung: Wenn wir den Pygmalion-Effekt nutzen wollen, sollten wir ihn nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere einsetzen. Wen halten Sie in Ihrem Umfeld für „nicht besonders talentiert“? Vielleicht lohnt es sich, Ihre eigenen Erwartungen zu hinterfragen – und jemandem die Chance zu geben, über sich hinauszuwachsen.